JET-SET
Die Einführung von Emissionshandelssystemen als sozial-ökologischer Transformationsprozess
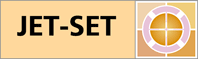
Mit der Entwicklung von Emissionshandelssystemen (EHS) wird der in Europa bislang vorwiegend ordnungsrechtlich ausgerichteten Umweltpolitik ein marktwirtschaftliches Instrumentarium hinzugefügt, das in seiner Ausgestaltung auf nationaler Ebene neue gesellschaftliche Chancen und Risiken birgt.
Über das Ausmaß der ökologischen, wirtschaftlichen, institutionellen und sozialen Folgewirkungen besteht jedoch großer Informations- und Forschungsbedarf - sowohl hinsichtlich des gegenwärtigen Systems als auch über zukünftige Designs ab 2008 bzw. für die 2. Kyoto-Verpflichtungsperiode ab 2012.
In dieses Informationsdefizit zielt das als transdisziplinärer Forschungs- und Lernprozess gestaltete, und vom Wuppertal Institut koordinierte, Verbundvorhaben JET-SET (Joint Emission Trading as a Socio-Ecological Transformation).
Die Zielsetzungen des Verbundvorhabens liegen
- in der wissenschaftlichen Begleitung der Einführung eines EHS in der EU und der Bundesrepublik Deutschland,
- in einer integrierten Abschätzung und Bewertung ausgewählter (zu erwartender) ökonomischer, ökologischer und sozialer Folgewirkungen eines europäischen EHS,
- in der Formulierung von Empfehlungen für die Ausgestaltung eines künftigen EHS und schließlich in einer
- konzeptionellen und theoretischen Einbettung der Forschungsergebnisse in die interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung.
In einer ersten Projektphase bearbeiten die Verbundpartner vier disziplinäre Basisprojekte ("Institutionen", "Risiko und Marktmacht", "Wahrnehmung und Diskurs", "Landnutzung und Energiepflanzen") und entwickeln ein gemeinsames integriertes Forschungskonzept für die 2. Projektphase.
In einer zweiten Phase bearbeitet die Projektgruppe vier integrierte Querschnittsprojekte ("Politikszenarien", "Klimaschutzszenarien, "Ökonomische und ökologische Wirkungen", "Institutionen").
Quer zu dieser Struktur liegen mehrere so genannte Ergänzungsprojekte, die sich u.a. mit der Entwicklung eines Forschungskonzeptes, mit geschlechtspezifischen Fragestellungen und mit der Evaluation des Gesamtvorhabens befassen.
Basisprojekt 1 "Institutionen"
Projektleitung: Christiane Beuermann (WI)
Bearbeitung WI: Tilman Santarius, Wolfgang Sterk, Christiane Beuermann, Hermann E. Ott, Ralf Schüle, Marcel Braun
Bearbeitung Partner: Marcus Stronzik, Marion Hitzeroth, Janina Onigkeit
Das Basisprojekt 1 "Institutionen" untersucht institutionelle Veränderungen in Gesellschaft und Politik während des Prozesses der Einführung von Emissionshandelssystemen in Europa. Institutionelle Veränderungen werden dabei aus politikwissenschaftlicher Perspektive anhand eines Mehrebenenansatzes betrachtet.
Das Basisprojekt verfolgt dabei zwei Ziele:
- Analyse des Aufstiegs, der (politischen) Restriktionen und der Einführung des Instruments Emissionshandel anhand seiner Diskussion auf allen politischen Ebenen, insbesondere der internationalen und der EU-Ebene
- Generierung theoretischer Erkenntnisse über die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen im politischen Mehrebenensystem und ihre Ableitung für strategische Empfehlungen.
Basisprojekt 2 "Risiko und Marktmacht"
Projektleitung: Ralf Schüle (WI)
Bearbeitung WI: Tilman Santarius, Wolfgang Sterk
Bearbeitung Partner: Marcus Stronzik, Marion Hitzeroth (ZEW), Janina Onigkeit (USF), Irmgard Schultz, Immanuel Stiess (ISOE), Markus Duscha (ifeu)
Das Ziel von Basisprojekt 2 "Risiko und Marktmacht" besteht darin, die in der Ökonomie idealisierten Annahmen über die Funktionsfähigkeit von Zertifikatemärkten in zweierlei Hinsicht zu hinterfragen. Zum einen wird die Prämisse aufgehoben, dass Marktakteure über vollständige Information verfügen (Teilprojekt "Risiko"). Marktakteure werden in ihrem Verhalten unter Unsicherheit untersucht. Zum anderen wird die Prämisse vollständiger Konkurrenz in Frage gestellt, indem analysiert wird, unter welchen Bedingungen Marktmacht und der Missbrauch von Marktmacht eine Rolle im Kontext eines Emissionshandelssystems spielen (Teilprojekt "Marktmacht").
Basisprojekt 3 "Wahrnehmung und Diskurs"
Projektleitung: Ralf Schüle (WI)
Bearbeitung WI: Tilman Santarius, Wolfgang Sterk
Bearbeitung Partner: Marcus Stronzik, Marion Hitzeroth (ZEW), Janina Onigkeit (USF), Irmgard Schultz, Immanuel Stiess (ISOE), Markus Duscha (ifeu)
Das Basisprojekt 3 "Wahrnehmung und Diskurs" nimmt die Diskussion um den nationalen Allokationsplan in Deutschland zum Anlass, diejenigen Prozesse und Aktivitäten zu rekonstruieren, die zur Ausgestaltung eines Emissionshandelssystems in Deutschland führten. Die zentrale Zielsetzung besteht darin auszuloten, ob sich aus der prozessualen Ausgestaltung und dem öffentlichen Diskurs um die Einführung des nationalen Allokationsplans in Deutschland wichtige Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Ausgestaltung künftiger Aushandlungsprozesse ziehen lassen. Dieser Fragestellung wird unter Berücksichtigung der institutionellen bzw. prozessualen Ebene (Gremien und Prozeduren) und der Diskursebene (öffentlicher Diskurs) der Einführung nachgegangen.
Zwei Ergänzungsprojekte befassen sich in diesem Zusammenhang mit Teilfragestellungen:
- Gender-Aspekte von EHS (Bearbeitung durch ISOE: Dr. Irmgard Schultz, Immanuel Stiess)
- Die Rolle der Kommunen und Bundesländer im europäischen EHS (Bearbeitung durch ifeu-Institut: Markus Duscha, Hans Hertle)
Basisprojekt 4 "Landnutzung und Energiepflanzen"
Projektleitung: Janina Onigkeit (USF)
Bearbeitung Partner: Marcus Stronzik, Christiane Beuermann, Tilman Santarius, Ralf Schüle, Marion Hitzeroth
Das Basisprojekt 4 "Landnutzung und Energiepflanzen" befasst sich mit der Integration des Land- und Forstwirtschaftssektors in ein Klimaschutzregime: Je nach Ausgestaltung der nationalen und internationalen Emissionshandelssysteme ist es möglich, dass auch der Land- und Forstwirtschaftssektor einen Beitrag zum Erreichen der deutschen Klimaziele leisten kann oder muss. Neben der möglichen Verpflichtung bietet eine Einbindung dieses Sektors in ein Klimaschutzregime die Möglichkeit der Erschließung neuer wirtschaftlicher Perspektiven, wie z.B. der im Nachhaltigkeitsbericht für Deutschland aufgeführte Anbau von Biomasse für die Energiegewinnung. Wie hoch die Potentiale für eine Energieproduktion in diesem Bereich sind und was die möglichen Begleiterscheinungen und Risiken sind, wurde bisher nur sehr grob erfasst. Angestrebt wird eine teils quantitative, teils qualitative Abschätzung dieser Größen mit Hilfe des Modellsystems, das im Rahmen des Basisprojektes "Landnutzung und Energiepflanzen" entwickelt wird.
Querschnittsprojekte
Das Verbundvorhaben befasst sich in der zweiten Projektphase mit den Potenzialen und Risiken einer Vernetzung des EU-Emissionshandelssystems mit anderen entstehenden Emissionshandelssystemen in Nicht-EU-Staaten und unternimmt eine integrierte Abschätzung und Bewertung dieser möglichen strategischen Verknüpfung von Systemen. Dabei werden folgende Fragestellungen bearbeitet:
- Welche Länder planen momentan den Aufbau eines nationalen CO2-Emissionshandelssystems? In welchen zeitlichen Dimensionen werden diese nationale Handelssysteme aufgebaut?
- Welche ökonomischen Wirkungen (Kosten, Zertifikatepreis) lösen verschiedene Alternativen ("storylines") der Verknüpfung des EU-Systems mit anderen nationalen Systemen aus?
- Können anspruchsvolle Emissionsreduktionsziele mit Hilfe der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen für die Phase nach 2012 erreicht werden?
- Welche institutionellen und prozeduralen Anforderungen müssen erfüllt sein, um potenzielle Verknüpfungen verschiedener Emissionshandelssysteme zu ermöglichen?
Folgende Querschnittsprojekte werden zwischen September 2004 und April 2006 bearbeitet:
- Politikszenarien (Koordination: Ralf Schüle)
- Klimaschutzszenarien (Koordination: Janina Onigkeit)
- Ökonomische und ökologische Wirkungen (Koordination: Niels Anger)
- Institutionen (Koordination: Wolfgang Sterk)
Ergänzungsprojekt 1 "Konzeptentwicklung"
Das Ergänzungsprojekt "Konzept" nimmt in der ersten Projektphase bis Dezember 2004 eine Schlüsselstellung in der Integration der Einzelprojekte ein.
In diesem Ergänzungsprojekt arbeitet das Projektteam heraus, wie eine gemeinsame übergreifende Forschungsperspektive für die 2. Projektphase (Querschnittsprojekte) entwickelt werden kann.
Entsprechend sind die Zielsetzungen des Ergänzungsprojekts
- interne Reflexion(-sfähigkeit) gewinnen
- die 2. Projektphase ("Praxisphase") vorbereiten
Ergänzungsprojekt 2 "Gender-Aspekte von Emissionshandelssystemen"
Generell haben geschlechterspezifische Fragestellungen in der Klimaforschung bislang nur eine geringe Beachtung gefunden. Auch Emissionshandelssysteme sind ein klimapolitisches Instrument, das bislang noch nicht unter genderspezifischen Fragestellungen betrachtet wurde. Weder wurden mögliche Unterschiede in der Akzeptanz dieses Instruments bei Männern und Frauen untersucht, noch wurden mögliche Folgewirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männer und die Folgen für die Geschlechterverhältnisse erforscht.
Die Zielsetzungen des Vorhabens bestehend daher darin, mögliche und relevante Fragestellungen in den Bereichen
- geschlechtsspezifische Einstellungen/Wahrnehmung des Klimaproblems allgemein (in Deutschland),
- geschlechtsspezifische Einstellungen/Einschätzungen der Klimapolitik (in Deutschland)
- geschlechtsspezifische Einstellungen/Einschätzungen von Emissionshandelssystemen
- geschlechtsspezifische Einstellungen zur Risikowahrnehmung bezogen auf Klima und EHS
zu sondieren. Die Rechercheergebnisse werden dokumentiert und für einen projektinternen Vermittlungsworkshop aufbereitet.
Ergänzungsprojekt 3 "Ökonomische Wirkungen"
Auf Anregung des Zuwendungsgebers werden zusätzlich zum ursprünglichen Projektantrag vom März 2002 Innovations-, Beschäftigungs- und Verteilungswirkungen von Emissionshandelssystemen (EHS) in die Betrachtungen aufgenommen. Ziel dieses Ergänzungsprojekts ist es daher, die für das vorliegende Forschungsvorhaben relevanten Ergebnisse zu Innovations-, Beschäftigungs- und Verteilungswirkungen von EHS aus der Literatur zu extrahieren und in die bestehenden Überlegungen zum Gesamtprojekt einzubeziehen.
Ergänzungsprojekt 4 "Strategien zum Emissionshandel auf kommunaler und Landesebene und Einbettung des Emissionshandels in neue Klimaschutzinstrumente auf nationaler Ebene"
Während der Emissionshandel in der Europäischen Union auf nationaler Ebene umgesetzt wird, stellt sich die Frage, in welcher Weise lokale bzw. regionale Institutionen wie Kommunen und Länder sich auf den Emissionshandel einstellen und in welcher Weise sie Beiträge zur Implementierung des Instruments leisten können.
In diesem Teilprojekt wird zudem untersucht, ob und wie das Instrument des Emissionshandels zur Steigerung der Energieeffizienz entwickelt werden kann. In der Diskussion marktorientierter Elemente des Klimaschutzes wurden z.B. schon "Grüne Zertifikate" (für Erneuerbare Energie) diskutiert. In Frankreich sollen "Weiße Zertifikate" zur Effizienzsteigerung von Energieanwendungen führen.
Kooperations- und Projektpartner im Rahmen des Forschungsprojekts
Wuppertal Institut:
- Dr. Ralf Schüle (Koordination)
- Dipl.-Vw. Christiane Beuermann
- Dipl.-Soz. Tilman Santarius
- M.A. Wolfgang Sterk
- Dr. Hermann E. Ott
Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung:
- Prof. Dr. Joseph Alcamo
- Dipl.-Chem. Janina Onigkeit
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung:
- Dipl.-Vw. Niels Anger
- Prof. Dr. Christoph Böhringer
- Dr. Andreas Löschel
- Dr. Ulf Moslener
Institut für sozial-ökologische Forschung:
- Dr. Irmgard Schultz
- Dipl.-Soz. Immanuel Stiess
Institut für Energie- und Umweltforschung:
- Dipl.-Ing. Markus Duscha
- Dipl.-Ing. Hans Hertle
Wissenschaftlicher Beirat:
- Prof. Dr. Hartmut Grassl, Max-Planck-Institut für Meteorologie
- Dr. Jaques Leonardi, Max-Planck-Institut für Meteorologie
- Dr. Josef Janssen, etsg AG
- Dr. Axel Michaelowa, HWWA - Internationale Klimapolitik
- Prof. Dr. Ortwin Renn, Akademie für Technik-folgenabschätzung in Baden-Württemberg
- MR Dr. Franzjosef Schafhausen, BMU - AG Z III 6
- Dr. Bodo Linscheid, BMU - AG Z III 6
- Dr. Erich Wallenwein, BMWA, Referatsleiter IV C 2
Mitglieder des Verbundvorhabens sind an zwei Querschnittsarbeitsgruppen in der sozial-ökologischen Forschung koordierend beteiligt:
- Dr. Irmgard Schultz (ISOE) koordiniert die Arbeitsgruppe "Gender".
- Dr. Ralf Schüle (WI) koordiniert die Arbeitsgruppe "Praxisintegration".
